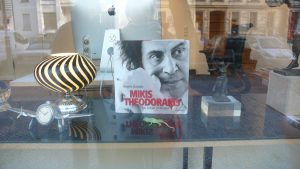Vor etwas mehr als einem Jahr stellte ich ein Foto von Marlene Dietrich neben ein Foto von Mikis Theodorakis.
Auf den ersten Blick gehörten sie zusammen. Zunächst „irgendwie“. Auf den zweiten Blick – es waren Monate vergangen – sah ich eines Tages, in welcher Hinsicht Theodorakis und Marlene Dietrich etwas verband.
Es ist nicht nur die Energie eines Atomkraftwerks sowohl Theodorakis als auch Marlene Dietrich eigen. Dass beider Vornamen mit M beginnen und Marlene Dietrichs angeblicher Lieblingsenkel Michael – also Michalis (oder abgewandelt Mikis) – heißt, das gehört in die Spielecke des Felds der Gemeinsamkeiten. Dass sich außerdem Schützen (Marlene Dietrich) und Löwen (Theodorakis) vertragen, ebenfalls. Als Marlene Dietrich am 6. Mai 1992 in Paris starb, feierte Mikis Theodorakis’ Sohn Giorgos noch den Ausklang seines 32. Geburtstages; zur Welt gekommen war er am 5. Mai 1960 in Paris. Die Familie Theodorakis hatte lange Jahre in dieser Stadt einen Lieblingsrückzugsort – wie bekanntlich auch Marlene Dietrich, die ihr Leben in der häufig erwähnten Wohnung gegenüber dem Hotel Plaza Athenée beschloss. Man möchte sich beinah gar nicht vorstellen, was hätte passieren können, wären Theodorakis und Marlene Dietrich sich im Leben begegnet. „Es hätte Booooom gemacht!“, singt es in mir. Völlig ausgeschlossen wäre dieses Booooom nicht gewesen. Es kam nicht dazu. Allerdings … Marlene Dietrich war ohnehin 24 Jahre älter. Allerdings … sie hatte auch eine Beziehung mit Yul Brynner, dem etwa 19 Jahre Jüngeren (manche Veröffentlichungen geben den Altersunterschied zwischen Marlene Dietrich und Yul Brynner mit 28 Jahren an). Marlene Dietrich wollte als 49-jährige von Yul Brynner gern schwanger werden, schrieb ihre Tochter Maria Riva im Buch über ihre Mutter. Maria Riva, so gut wie gleichaltrig mit Theodorakis. Im Internet finden sich Fotos, die Edith Piaf und Mikis Theodorakis zeigen, als sie im Studio „Omorphi Poli“ aufnahmen – ein Lied, das die Friedrich-Hollaender-inspirierte, Claire-Waldoff- und Edith-Piaf-geschulte Marlene Dietrich ebenfalls gemeistert hätte, wie sie auf ihre Art, zärtlich und unikal, „Allein in einer großen Stadt“ zu singen verstand.
Die Lieder, die Theodorakis als Kind und Jugendlicher hörte, Schlager wie „La Paloma“, sie gehörten ebenfalls zu Marlene Dietrichs freudigen musikalischen Erinnerungen an frühere Zeiten. Für beide – sowohl für Theodorakis als auch für Marlene Dietrich – war das Grammophon ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt, um den das Leben zu kreisen schien, die Welt, überhaupt alles …, später abgelöst vom Plattenspieler und natürlich auch von Strawinskys „Le sacre du printemps“. Damit an dieser Stelle genug des Umkurvens der für mich momentan interessanteren Marlene Dietrich und Mikis Theodorakis verbindenden Aspekte.
Wesentlicher finde ich:
Jeden der beiden verfolgte über Jahrzehnte jeweils eine Figur, die er / sie entweder mit erschaffen oder verkörpert hatte und mit der er / sie von da an das ganze Leben identifiziert wurde. Eine jeweils musikalisch hochenergetische Gestalt, die zudem für eine bestimmte Art stand, durch das Leben zu gehen. Die Lola Lola der Marlene Dietrich. Der Zorbas des Mikis Theodorakis. Sofort sehe ich einen großen Film vor mir, der dem Kinopublikum ermöglicht dabeizusein, wenn diese beiden Gestalten, Lola Lola und Zorbas, sich (mithilfe filmischer Mittel und ungebremst von Zeitschranken) begegnen und „gemeinsam was anstellen“. Eine „Monte Carlo Story“ wird dabei nicht herauskommen. Eine nette Ganoverei anderer Art könnte es wohl werden.
Ob Zorbas am Strand tanzte oder Lola Lola im Varieté „Der Blaue Engel“ ihre Beine zeigte und sang – beide gelten sie als subtile, meisterhafte Verführer, „schräg“, in ihrer Widersprüchlichkeit authentisch – und irgendwie ehrlich, da sie sich ihre Kunst der Verstellung anmerken lassen. Sie laden den Verführten direkt dazu ein, als präsentierten sie sich persönlich vor Hermann Hesses metaphysischem „Magischen Theater“ und drückten dem Steppenwolf ihre Personalakte in die Hand, ohne Maske, Make-up, ohne Handschuhe zu tragen, als würde der Steppenwolf geradezu aufgefordert, genau hinzukucken, die Augen offenzuhalten, wenn die Künstlerin Fröhlich die Lider senkt und die Lieder singt oder wenn Zorbas mit den Fingern schnippst. Als würde der Steppenwolf freizügig eingeladen, beim Schminken und Umkleiden zuzuschaun und der Verwandlung in ein diabolisch berückendes, entwaffnendes, tänzerisch gestimmtes Wesen beizuwohnen. Lola Lola und Zorbas sind so genannte „Naturtalente“. Vielleicht sogar die Unschuld in Person. Man kann sich Lola Lola ohne weiteres als diejenige vorstellen, die einen Sirtaki auf die Bühne bringt, und Zorbas als einen Typen, der mit Lola Lola ein Ding drehen will, wenn auch auf andere Art als Hans Albers-Mazeppa-Iwan-Masepa hinter der Bühne, hinter dem Rücken von Unrath, während dieser durchdreht.
Zorbas wär ein hervorragender schuldiger Attraktiver, den man einer Lola Lola einfach verzeihen muss und dessen Existenz alles an Ungereimtheiten erklärt. Zorbas hätte auch der bevorzugte ferne, vermutlich irgendwo doch existierende Geliebte sein können, für den Amy Jolly in „Marokko“ und Helen in „Entehrt“ Beziehungen oder Chancen erst recht und nochmals sausen lassen, die ihre Existenz vielleicht doch gesichert hätten, ihnen den Hintern gerettet und ein „Zuhause“ beschert. Zorbas könnte derjenige gewesen sein, abwesend, unerreichbar, doch im Leben der Spanischen Tänzerin vielleicht genau dieser, welcher sie so verschlagen sein lässt, unergründlich und imstande, jeden ernsthaften Liebhaber schließlich abzuwimmeln. Oder derjenige, welcher die undurchschaubare, rätselhafte Shanghai Lily melancholisch und vorsichtig werden ließ, und der die Scharlachrote Kaiserin zu so einigem ermutigen konnte, vor allem als ehemals preußische Prinzessin das Zarenreich an sich zu reißen. Lola Lola wäre ihrerseits für Zorbas die Frau, die – seiner Erfahrung nach – beinah allen Frauen innewohnt und der es nur zu begegnen gilt. Die kretische Witwe, die gelyncht wird vom Mobb, der ein Opfer sucht, sie wird immer wieder auferstehen in Lola Lola, neugeboren, anders, geistesgegenwärtig, flink, auf Zack, schlagfertig, lyrisch veranlagt, fähig, Spiegeleier zu machen und gleichzeitig die Garderobe für den Bühnenauftritt flugs bereitgelegt zu haben. Mit geübten Handgriffen zieht sie schnell noch die Linie ihrer Augenbrauen nach. Dass die kretische Witwe eine viel vollere und dunklere Haarpracht sehen lässt als die Berlinerische Lola Lola … kein Hindernis.
Lola Lola hat immer eine überzeugende Idee, in Misslichem etwas Gewinnbringendes zu entdecken. Oder sie hat eine Perücke, die sie hexerisch zeigte. Jedenfalls findet sie einen Ausweg, für sich oder andere. So auch Zorbas. Dieses deutsch-griechische Gespann vermag Spree-Athen mehr noch als unsicher womöglich sicherer zu machen. Berlin bliebe das, was es seit den 20er Jahren ist, und gewänne etwas von dem zurück, was es verlor nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Berlin konnte diesen atemberaubenden Lebenshauch der so genannten Goldenen 20er Jahre nie wieder in seine Brust einströmen lassen. Doch die Stadt ringt darum, wenn auch wie ein Fisch, halb auf dem Trocknen. Lola Lola und Zorbas würden Berlin ein paar Kinder schenken mit kräftigen Lungen. Eine gelungene Sache – Amour & Kultur.
Lola Lola und Zorbas sind leiderfahren und schelmisch – nicht zuletzt, weil sie den Ersten Weltkrieg überlebt haben und sich durchschlagen müssen in beruhigteren Zeiten. Gemeinsam hätten sie sehr gut angetreten sein können gegen eine Diktatur, die in Griechenland Miniröcke, Rock’n Roll und überhaupt alles verbot, was Menschen zu träumerischen Gefühlsaufwallungen, zur Lust nach Abwechslung und Widerstand hätte bewegen können. Sowohl Marlene Dietrich als auch Mikis Theodorakis verweigerten, sich autoritären Machthabern anzudienen.
Beide kommen eigentlich aus konservativen Elternhäusern, in denen gelesen wurde, aus einer Kindheit und Jugend mit vielen Umzügen, beide hatten musikalisch angehauchte Mütter, die kochen und haushalten konnten, beide lernten Geige spielen. Beide hätten sich jeweils schön gemütlich einrichten können und einfach im Rahmen des Möglichen auch in restriktiven Systemen arbeiten, die Klappe halten und Musike machen, denn sie waren jung, immerzu verliebt, charismatisch, hungrig, sie brauchten Geld, die Bühne, Publikum, Auftrittsmöglichkeiten.
Beide Biografien weisen die Besonderheit auf, dass sowohl Marlene Dietrich (Deutschland) als auch Theodorakis (Griechenland) jeder für sich international immer wieder als bedeutendste Künstler ihres Herkunftslandes gelten. Andererseits waren sie mit Verachtung konfrontiert, und ihnen wurde bedeutet, dass sie angeblich in ihr Heimatland nicht so richtig hineingehören, dass sie abhauen sollen oder den Mund halten. An beiden hat die Presse sich ausgelassen – beide waren immer ein Thema, das „zog“. So oder so. Es hat eine Ewigkeit gedauert, bis man sich in Berlin entschließen konnte, einen Platz nach Marlene Dietrich zu benennen. Und es ist höchst lächerlich und bezeichnend, dass weder die griechische Regierung, noch Stadien-Eigentümer in Athen, noch irgendeine frisch entschlossene Gruppe verschiedener griechischer Musiker es fertigbringen wollte, den 90. Geburtstag von Theodorakis Ende Juli 2015 mit einem großen vielfarbigen Konzert in Athen zu feiern. Man war absolut nicht scharf auf so ein Erlebnis, auf eine Nacht voller Musik, man wollte einfach nicht. Von den Gefragten war allerdings Maria Farantouri augenblicklich bereit und bewies damit eine gewisse Courage, die man auch zu DDR-Zeiten brauchte, wenn man nicht am Stumpfsinn verrecken oder vom „es nützt ja doch nichts“ farblos werden wollte. Es offenbarte sich in diesem sturen Verhindern einer großen klangvollen Geburtstagsfeier für den 90jährigen Theodorakis, in diesem Zögern, Hinhalten, Erklären, Zerreden, Verweisen auf die offene Frage, wer Ende Juli die Regierung bilden würde, oder im Verweisen auf Manos Hatzidakis oder auf die Ecken und Enden, an denen alles fehle, eine kolossale Beschränktheit, Engherzigkeit und Intoleranz, eine kackspechtige Verbohrtheit, eine armselige Armseligkeit, Pedanterie, Schlaumeierei und Gehässigkeit, die zwar nicht die von 1972 war, aber die von 1972 in 2015-er Samteinkleidung. Es hätte auch das andersverstimmte, janusköpfige Lechzen sein können, das Marlene Dietrich ihrerseits riechen konnte, wenn sich Vertreter der UFA und andere Personen in den 30er Jahren nach Paris begaben, um sie nach Deutschland zu locken. Einer tanzte gar mit einem Weihnachtsbaum an.
Der eine wird verhindert, der andere soll mit Häppchen geködert werden. Hauptsache man spurt und unterwirft sich einer Nebelkammer-Instanz, die sich als mächtig genug wahrnimmt, um Musikern ans Bein pinkeln zu können. Wenn man nicht kuscht, wird man verrissen oder schleichfüßig über- oder umgangen. Passive Agressivität – so könnte man es auch nennen, weiter genährt nach Diktatorenzeiten. Rache, Überlegenheitsdünkel, kleinkarierte pikierte Geniertheit, die sich in eigentlich friedlichen Zeiten ausgewachsen hat zu Ratlosigkeit, Pedanterie, Frustration und hochengagierter Verhinderungslust, die sich gern vernunftgeleitet und wohlbedacht gibt … Diktaturen mögen vor allem das nicht: Menschenkindern vom Klapperstorch mit in die Wiege gelegten Sex-Appeal und Mutterwitz, weder Rock’n Roll noch Jazz noch kretische Mantinaden, weder das Schiff, das kommen wird, noch die Seeräuberjenny, keine Musiker, die sich frischfrech hinstellen und lautstark „Es geht mir gut es geht mir gut es geht mir gut!“ zum Besten geben. Das können die Entscheider, die Spielstättenhaber nicht vertragen. Da kriegen sie Gallenkoliken oder Nierenschmerzen. Dafür stellen sie keine Hallen, Stadien oder öffentliche Plätze zur Verfügung im eigenen Land. Dafür machen sie keinen Raum frei. Gouvernanten, die für sich in Anspruch nehmen, die Programmgestaltung besser machen zu können als die Musiker. Ich rieche Menschenfleisch. Ein wohlbekannter Sänger Griechenlands hat jetzt Luft geholt und wohl bekannt, dass er den Theodorakis zu lange verdrängt hat. Damit aber auch den Hatzidakis, letztendlich. Und letztendlich geht Griechenland den Bach runter, ohne die beiden und mit der Verhinderung, meine ich.

Nach einer langen Eiszeit wird wieder und wieder das Frühlingsopfer vollzogen, die alten Götter ziehen sich zurück, der „alte Winter in seiner Strenge“, die jungen Götter brechen auf und nahen von hinten und von vorn, mit Pinseln und mit Notenschlüsseln, mit Windfahnen, Kameras, auf Schwalbenflügeln, mit Papierdrachen und Phönixen, mit Marlene Dietrichs Kochtöpfen und Theodorakis’ Zigarren, die Erde übergießt sich mit Krokussafran, Anemonenblut, Blausternseen, mandelbaumrosafarbenem Märzenmarzipan, Anne Franks April-Kastanie und der weiße Maien-Flieder blühen wild, auch wenn es regnet. Einer wird sich an den Konzertflügel setzen, Chopin spielen und dann, sehr langsam, leise, so, dass aus den Fragen Antworten hervorgehen, auch das: „Sag mir, wo die Blumen sind“, ein Lied, ein Blues, der in dieser Zeit auf eine zärtliche, kräftige Erneuerung wartet, gesungen von einer starken Stimme – im „Blauen Engel“ von Athen, von Hitchcocks Roter Lola. Sagen wir so.
Marlene Dietrich und Mikis Theodorakis lassen sich von der Quadriga kutschieren – in mancherlei Hinsicht scheinen sie vom selben Planeten zu stammen. Sie sind vielleicht von dort, wohin der Kleine Prinz verschwunden ist. Darüber kann der Fuchs uns mehr sagen und auch das Äffchen, das auf des Leierkastenmanns Box tanzt. Lola Lola und Zorbas – die besten Botschafter für Berlin und Athen. Auch unrunde Geburtstage können gefeiert werden. Ab dem 90. liegt das in der Natur der Sache, Musikern am Herzen und im Sinn. Jedes Jahr zählt von da an ein Menschenjahrzehnt. Jeder Mensch ist ein Musiker. Ich atme musikalische Radio-Aktivität. Ich will wieder wissen, wo die Blumen sind, ein Vierteljahrhundert, nachdem Marlene Dietrich sich in den Schatten weißblühenden Flieders legte. Lola Lola und Zorbas – nach ihre Beene is ja janz Berlin verrückt.
Text & Photos © by Ina Kutulas